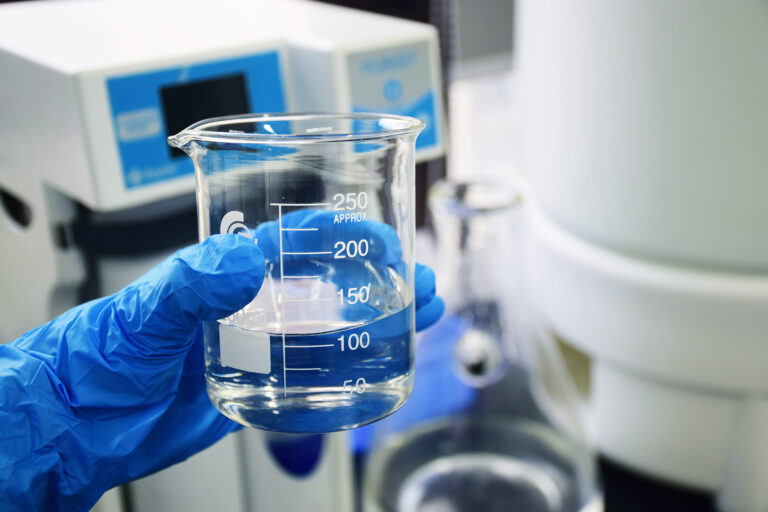
In vielen Betrieben werden krebserzeugende und erbgutverändernde Stoffe verwendet. Je nach Höhe und Dauer der Exposition muss eine Untersuchung (früher G 40-Untersuchung genannt) durchgeführt werden. Dabei handelt es sich sowohl um eine Angebotsvorsorge als auch um eine Pflichtvorsorge.
Krebserzeugende und erbgutverändernde Stoffe gehören in rund einer Million Betrieben in Deutschland zum Arbeitsalltag. Da die Unternehmen aber bis heute nicht verpflichtet sind, den Behörden zu melden, ob, wo und in welchen Mengen sie diese Gefahrstoffe einsetzen (ausgenommen sind lediglich Abbruch- und Sanierungsarbeiten), oblag es lange Zeit allein der Unternehmensleitung, für die Sicherheit ihrer Beschäftigten zu sorgen.
Mit dem Expositionsverzeichnis sind Unternehmen verpflichtet, die Höhe und Dauer der Exposition gegenüber krebserzeugenden und erbgutverändernden Gefahrstoffen zu dokumentieren. Die Angaben werden aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleitet. Das Verzeichnis wird personenbezogen geführt und von den Gewerbeaufsichtsämtern überprüft.
Nach der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) müssen Unternehmer bei allen Tätigkeiten mit krebserzeugenden und erbgutverändernden Gefahrstoffen der Kategorien 1 und 2 eine arbeitsmedizinische Vorsorge durchführen. Ziel ist es, die Beschäftigten vor Erkrankungen zu schützen und mögliche gesundheitliche Folgen frühzeitig zu erkennen.
Um welche Gefahrstoffe handelt es sich?
Es gibt verschiedene Stoffe, die Krebs erzeugen oder das Erbgut verändern können. Dazu gehören Beryllium, Acrylnitril, Kobalt, Epichlorhydrin und andere Stoffe. Ob diese Stoffe in den jeweiligen Arbeitsbereichen eingesetzt werden, muss durch eine Gefährdungsbeurteilung geklärt werden.
Gib hier deine Überschrift ein
Ob es sich um eine Angebots- oder eine Pflichtvorsorge handelt, hängt von folgenden Fragen ab:
- Zu welchem Risikobereich gehört der Gefahrstoff?
- Wird der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) überschritten?
- Wie lange und wie häufig ist man dem Stoff ausgesetzt?
- Um welche Tätigkeit handelt es sich?
Für krebserzeugende und erbgutverändernde Gefahrstoffe gibt es in der Regel keinen AGW, da sie keine Wirkungsschwelle haben, unterhalb derer kein Krebsrisiko besteht. Daher wird das Krebsrisiko für die meisten Stoffe anhand der Expositions-Risiko-Beziehung (ERB) ermittelt. Je nach Höhe der Konzentration werden die Stoffe mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet.
Die Farbe Gelb bezieht sich auf Beschäftigte, die in einem Bereich arbeiten, in dem der Mittelwert der Exposition zwischen der Akzeptanz- und der Toleranzkonzentration liegt. Beschäftigte, die im Akzeptanzbereich (geringes Risiko, Farbe grün) oder im Toleranzbereich (mittleres Risiko, Farbe gelb) arbeiten, sind keiner erhöhten Gefährdung ausgesetzt. Der rote Bereich hingegen stellt ein hohes Risiko dar, da der Mittelwert die Toleranzkonzentration überschreitet. Für einige Stoffe, wie z.B. Beryllium, kann ein Arbeitsplatzgrenzwert abgeleitet werden, da es eine Wirkschwelle gibt.
In folgenden Fällen spricht man von einer Pflichtvorsorge:
- Der zulässige Arbeitsplatzgrenzwert für Gefahrstoffe der Kategorien 1 und 2 der Gefahrstoffverordnung wird überschritten.
- Der Gefahrstoff gehört zum hohen Risikobereich (roter Bereich).
- Eine erneute Exposition ist möglich.
- Bei der Tätigkeit handelt es sich um eine krebserzeugende Tätigkeit der Kategorie 1 und 2 nach Gefahrstoffverordnung.
- Es besteht die Möglichkeit des Hautkontaktes mit dem Stoff und damit ein erhöhtes Gesundheitsrisiko.
In allen anderen Fällen handelt es sich um eine Angebotsvorsorge.
In welchen Abständen sind die G 40-Untersuchungen durchzuführen?
Die Erstuntersuchung muss vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Die erste Nachuntersuchung erfolgt bei Exposition gegenüber krebserzeugenden und erbgutverändernden Stoffen der Kategorie 1 und 2 frühestens nach 12 Monaten, spätestens nach 24 Monaten. Weitere Nachuntersuchungen erfolgen in Abständen von jeweils weiteren 24 Monaten.
Auf Wunsch des Arbeitnehmers, nach längerer oder schwerer Erkrankung des Arbeitnehmers, die zur Aufgabe der Tätigkeit führen kann, oder nach ärztlichem Ermessen können die Nachuntersuchungsfristen verkürzt werden. Liegt keine kritische Exposition gegenüber krebserzeugenden Stoffen der Kategorie 1 und 2 vor (aber eine Exposition gegenüber krebserzeugenden Stoffen im Konzentrationsbereich mit niedrigem und mittlerem Krebsrisiko), können die Nachuntersuchungen auch alle 24 bis 60 Monate durchgeführt werden. Auch bei Beendigung der Tätigkeit wird in der Regel eine Nachuntersuchung durchgeführt.
Wie laufen die G 40-Untersuchungen ab?
Die Erstuntersuchung umfasst eine ausführliche Erhebung der Arbeits- und Krankheitsgeschichte sowie eine tätigkeitsbezogene Untersuchung.
Die G 40-Untersuchung umfasst sowohl bei der Erst- als auch bei den Folgeuntersuchungen folgende Punkte:
- Anamnese (Befragung nach medizinisch relevanten Informationen) im Hinblick auf die Tätigkeit,
- Untersuchung im Hinblick auf die Tätigkeit,
- Laborwerte (u. a. Blutsenkung, großes Blutbild, Urin),
- gegebenenfalls Röntgenaufnahme des Thorax (Brustkorbs),
- ggf. weitere spezielle Labor- und/oder medizintechnische Untersuchungen,
- ggf. Biomonitoring (Untersuchung von biologischem Material der Beschäftigten auf Gefahrstoffe),
- ggf. Hautresorptionstest.
Jetzt Gespräch vereinbaren
Kommen Sie gern auf mich zu und wir vereinbaren ein unverbindliches Beratungsgespräch.

